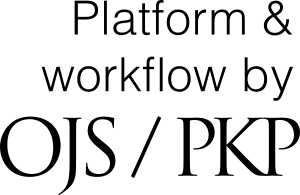The Origin of Love (Hedwig and the Angry Inch)
Über Komplementarität, queere Populärkultur und Kugelmenschen
DOI:
https://doi.org/10.30820/0942-2285-2025-1-61Schlagworte:
The Origin of Love, Hedwig and the Angry Inch, Tiefenhermeneutik, Queer-Theorie, Symposion, KugelmenschenAbstract
Das Musical Hedwig and the Angry Inch gilt als Klassiker der queeren Populärkultur. Der Song The Origin of Love veranschaulicht die verzweifelte Suche der queeren Protagonist*in Hedwig, die nach einer missglückten Geschlechtsumwandlung weder männlich noch weiblich, weder homosexuell noch heterosexuell ist, nach der anderen Hälfte, die das eigene Selbst komplettieren kann. Er referiert auf Platons Symposion und bietet eine Neuerzählung des Kugelmenschen-Mythos. Die Figur Hansel*Hedwig, die durch die misslungene Geschlechtsumwandlung in sich selbst gespalten ist, repräsentiert die Teilung der Kugelmenschen durch die Macht der mythologischen Götter, deren Effekt die Trennung von zwei zusammengehörenden Hälften ist. Im Rahmen einer tiefenhermeneutischen Interpretation wurde der Song analysiert. Der Beitrag fokussiert die Rekonstruktion dieses Interpretationsprozesses unter Bezugnahme auf die queer-feministische Theorie Judith Butlers und die Bedeutung des Songs für die queere Populärkultur.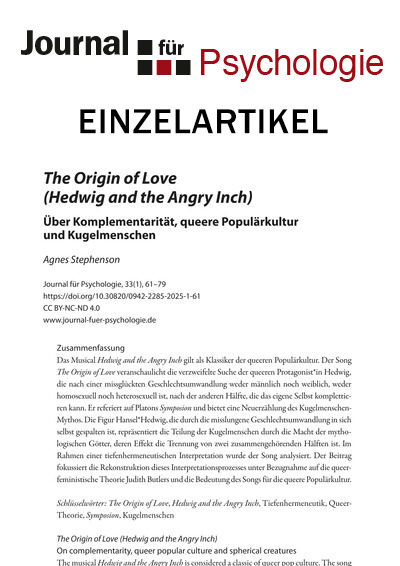
Zitationsvorschlag
Stephenson, Agnes. 2025. „The Origin of Love (Hedwig and the Angry Inch): Über Komplementarität, Queere Populärkultur Und Kugelmenschen“. Journal für Psychologie 33 (1):61-79. https://doi.org/10.30820/0942-2285-2025-1-61.
Ausgabe
Rubrik
Artikel
Lizenz

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International.
Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung und unveränderte Weitergabe, verbietet jedoch die Bearbeitung und kommerzielle Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z. B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.